
Wenn ich, allen meinen Vorbehalten gegen öffentliches Tagebuchschreiben zum Trotz, nunmehr auch selbst ein öffentliches Tagebuch anlege, so ist das in allererster Linie eine rein private Disziplinierungsmaßname, um meine in letzter Zeit ganz arg vernachlässigte Schreibmoral wieder auf eine annehmbare Stufe zu bringen; und im Weiteren & zusätzlich halt noch den paar wenigen gewidmet, die mich kennen oder auch nicht kennen und denen det interessant sein könnte. Eine Maßnahme, zu der ich mich bereits vor zwei oder drei Wochen entschlossen hatte und deren Inangriffnahme ich dann immer wieder hinauszögerte. Da mir aber scheint, als sei es – zumindest für mich selbst – nötig, sei es denn hiermit in Angriff genommen.
Und obwohl ich seit Jahren von früh bis spat nur Russisch spreche und fast nur Russisch lese; obwohl ich mich nirgends so fremd fühle wie in den europäischen Gefilden – schreibe ich diese laufenden Notizen in Deutsch; was mich sogar selbst etwas wundert; doch schließe ich nicht aus, daß ich nach und nach zum Russischen übergehe.
♦ ♦ ♦
Was war denn so los in den letzten Monaten? Eigentlich recht wenig. Oder auch viel. Im Dezember etwas herumgereist; in einstmals heimischen oder zumindest einstmals als Aufenthaltsbereich dienenden westlichen Gefilden.
Die „Violette Auster“, ein letzten Sommer begonnenes internationales Erotikprojekt, welches ich – nur ganz nebenbei um der Erotik willen, vornehmlich aber deswegen, um die Kreise und Möglichkeiten zu erweitern – vom Zaune gebrochen hatte, hatte sich zwar gleich bei seiner Geburt festgefahren und war von mir aufgegeben worden; doch schloß ich nicht aus, daß ich es in der Richtung nochmal versuchen könnte[1].
Zunehmend an Aktualität gewann die Zusammenarbeit mit dem Frank’schen Sprachenportal; auch nicht uninteressant und durchaus geeignet zur Erweiterung der Kreise und Möglichkeiten.
Zwischendurch Anfälle von Resignation und starkem Widerwillen gegen das Schreiben. Wohl wissend, daß letztendlich nix mich klein kriegt, überließ ich zunächst mal der Resignation das Feld – taktischer Rückzug gewissermaßen – und konzentrierte mein Geschreibe unter anderem auf die Zusammenarbeit mit dem russischen Sprachenportal; was dann vor kurzem zur Eröffnung einer deutschsprachigen Filiale führte. Alles durchaus positiv; nich; und ohne diese Resignation wäre sie, diese Filiale, vielleicht gar nicht zustandegekommen[2].
Von internationalen Erotikprojekten zur „Erweiterung der Kreise“ seh ich bis auf weiteres ab; schließe aber nicht aus, daß ich es, so ich sonst nicht weiterkomme, wieder aufgreife; nur muß das dann ganz anders angepackt werden; und ohne Gewährleistung eines über die Erotik hinausreichenden Mindestniveau brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Punkt.
Auch über unsere ganzen Strömungsaggregate und Filtermaterialien[3] lohnt es sich kaum zu reden; das ist so festgefahren, daß ich keine Ahnung habe, wie man es wieder flottkriegen könnte. Vor ein paar Tagen rief Irakli an; irgendwelche Schreiben vom Patentamt, um die wir uns kümmern müssen; wobei weder er noch ich eine Ahnung haben, was man bei unserem Abgeschnittensein da noch machen könnte. Überall wird groß geredet und sinnlos Geld zum Fenster rausgeworfen; aber klein wenig Interesse und Finanz für ganz reale Sachen, die mit geringem Aufwand in einem vor sich hin vegetierenden Lande größere Mengen an Arbeitsplätzen schaffen könnten – iss nu mal nicht da.
Vor kurzem wurde dann noch mehr oder weniger versehentlich der multikulturelle vielsprachige Международный Союз Неудачников gegründet, den wir nun, trotz seiner Versehentlichkeit, weiterführen werden. Eine der Aktualität nicht entbehrende Angelegenheit.
Nach dieser erstmaligen Goodwillbekundung, das als notwendig betrachtete tatsächlich in Angriff zu nehmen, lassen wir es mal für heute genug sein.
Prost.
Epizentrum der Klamurke ist das Problem der Versurrogatierung der Sprache und deren Auswirkungen auf die Orientierungsmöglichkeiten und die Entwicklung des Einzelnen; während es beim Международный Союз Неудачников mehr um die sozialen Konsequenzen dieser Versurrogatierung geht; darunter auch: Unfähigkeit, die faktischen Fähigkeiten, Möglichkeiten, Bestrebungen des Einzelnen zu erkennen und anzuerkennen und die sich daraus ergebende soziale Isolation, die Schwierigkeit bis Unmöglichkeit für den Einzelnen, zu seinem und seiner Umgebung Vorteil seinen Platz im Leben zu finden.
Espressotrinkend hab ich auf die Schnelle noch ein paar Texte aus meinen Reserven in die Klamurke hochgeladen; darunter auch „Die Entkleidung der Kellnerin“. Letzteres nach einigem Zögern. Doch was soll's. Veröffentlicht ist er eh bereits; und zwar, wenn ich mich nicht täusche, bei „Erozuna“ und, sogar in Deutsch und in Russisch, in der steckengebliebenen „Violetten Auster. Warum nicht auch in der Klamurke? Eben da gehört er rein, der Text. Er gehört sicher nicht zu dem besten, was ich geschrieben habe; aber sprachlich isser doch recht spritzig; und zumindest durch diese seine Spritzigkeit weist er hinaus über die vordergründige erotische Thematik und verbindet sich, über selbige Grenzen hinausgehend, mit dem allgemeinen klamurkischen Geist.
♦ ♦ ♦
Svetlana, die im Sprachenportal die Webmasterin macht, scheint verreist. Antwortet nicht; Material, welches ich bereits vor einer Woche rübergeschickt habe, wird nicht plaziert. Was ich ausgesprochen ärgerlich finde, da diese Sprachportal-Filiale vor allem in der Anfangszeit eine energische Entwicklung und Ausweitung fordert. Selbst verfüg ich grad über genügend Zeit und kann zumindest für die Russischecke zügig große Mengen an Material produzieren; doch nützt das alles nichts, wenn es nicht genau so zügig veröffentlicht wird. – Machte mich alles recht nervös; denn ich brauch die Bewegung – und besonders hier ist sie ja, unabhängig von meinen Vorlieben, mehr als angebracht, die Bewegung – und hab so meine Probleme, wenn wat ins Stocken kommt. Gestern deponierte ich kurzerhand eine Ladung fertiger Sachen an einer mir zugänglichen Stelle im Internet und setzte im Forum ein Link dortselbsthin; und nun fühl ich mich wieder wohler.
Вперёд!
Das Bearbeiten der Texte für das Sprachenportal bezeichne ich als „Aufbereiten“. Georges findet das komisch. Isses ja auch; aber mir fiel bislang nix besseres ein.
Ilja Frank bezeichnet dieses Bearbeiten als «адаптировать», adaptieren. Dieser Ausdruck scheint mir zu belastet, da damit in der Regel ein Heruntervereinfachen schwieriger Texte auf Anfängerniveau gemeint ist.
Wir verändern die Texte ja nicht; bringen nur parallel eine möglichst wortwörtliche Übersetzung und kommentieren sie, um sie auf solchem Wege auch Anfängern zugänglich zu machen. Vielleicht nenn ich das in Zukunft denn ganz einfach: übersetzen und kommentieren? Sind zwar gleich zwei Verben; aber dafür wird genau das gesagt, was gemeint ist.
Das übliche „Adaptieren“ von Texten betrachte ich übrigens als groben Unfug. In der Regel sind das ja Sachen von seriösen oder als seriös betrachteten Schriftstellern, die als Bildungsgut gelten und die man deswegen „gelesen haben muß“. - Nun ist es aber so, daß die Texte von wirklich seriösen Schriftstellern nicht nur aus der Handlung leben, sondern viel mehr noch: aus der Sprache; beziehungsweise daß der Inhalt sich bis in die Feinheiten der Sprache hinein erweitert; und wenn man nun hingeht und die Sprache auf Anfängerniveau hinuntervereinfacht, so hat das Resultat ja im Prinzip mit der ursprünglichen Sache außer einer vordergründigen Übereinstimmung der aller Feinheiten entblößten Inhaltlichkeit kaum noch wat zu tun. - Von irgendwelchem zum Bildungsgut ernannten Autoren nimmt man also den Namen und verschiedene vordergründige Inhalte eines seiner Werke, um damit dem Sprachanfänger die wohlige Gewißheit zu verleihen, daß er gebildet ist und in der fremden Sprache schon richtige anerkannte Autoren gelesen hat. Muß das sein? Dem Aneignen der Sprache und Sicheinleben in die fremde Kultur dürfte es wohl kaum dienlich sein; aber ansonsten: für eine Zeit, da man sich wenig um das kümmert, was „Sache“ ist und dafür mehr um Etikettenkleben und показуха – eine ganz nette Sache.
Ja.
Die besten Vorsätze nützen nix, wenn zu deren Durchführung elektrischer Strom benötigt wird und wenn selbiger die meiste Zeit über nicht da ist. Wasletzteres nun bereits seit gut einer Woche der Fall ist. Versuche, mich auf Nachtarbeit umzustellen (nachts ist meist Strom da) brachten nix; nachts krieg ich nix auf die Reihe. Stand denn frühmorgens auf, um wenigstens das allernötigste erledigen zu können.
Gestern war es erstmals klein wenig besser: Zehnminütiger Aussetzer irgendwann nach 7; und dann war er am frühen Nachmittag nochmal anderthalb Stunden weg.
Svetlana hat mir die Zugangsdaten für das Sprachenportal geschickt; und nun veröffentliche ich die Materialien für mein Ressort selbst. Was zunächst die Hoffnung weckte auf energische Entwicklung; doch kaum befanden sie, die Zugangsdaten, sich in meinen Händen, wie auch schon die einsetzenden Stromausfälle all dem einen Riegel vorschoben.
Gestern früh nutzte ich den Strom unter anderem dazu, in dem anstehenden – sehr langen – Janov-Kapitel die betonten Silben zu markieren. Läßt sich anders nicht machen, alsda Lesestoff für Russisch-Anfänger ohne Betonungsmarkierungen nu mal nicht zu gebrauchen ist. Und so hockt man denn vor dem Schirm, jeden Moment gewärtig, daß er dunkel wird, markiert in wilder Hektik – um bis zum nächsten Abschalter möglichst viel durchzukriegen – mit der Maus, einen nach dem anderen, die betonten Vokale und setzt sie kursiv; und alle paar Vokale, natürlich, abspeichern. - Was bei einem Gedicht oder einem kürzeren Text unter normalen Bedingungen lästig iss; bei einem 9 Seiten starken Prosatext unter dem Damoklesschwert eines Stromausfalls aber ganz einfach ein Martyrium.
Und wie ich mir dann schließlich eine Espressopause gestattete, da tat mir der rechte Arm weh; und ich gedachte jener unglückseligen Zeitgenossen, die sich von früh bis spat in Computerspielen ergehen: da wird der Mausarm wohl irgendwann zur Gänze atropieren…
Den Janov-Text hab ich aus einer ganzen Reihe von Gründen ausgewählt: Zum einen bin ich der Ansicht, daß es günstiger ist, wenn der Russischlernende sich in die Sprache einarbeitet anhand von Material, welches ihm ein Bild vermitteln kann von dem, was so alles in den Anfängen dieser Sowjetzeit ablief und von dem man in Deutschland sonst nicht viel weiß; und dann ist dieser Janov ein Mensch von beeindruckender Konsequenz; und sicher ist es nicht schlecht, sich während des Sprachstudiums (oder auch ganz einfach so) mit solch konsequentem Menschen bekannt zu machen. Und seine Sprache ist sehr einfach; so einfach, daß man sie Anfängern in kommentierter Form durchaus zumuten kann.
Ein weiterer Vorteil, den man zunächst als Nachteil betrachten könnte, ging mir während des Arbeitens auf: Janov ist kein geübter Schreiber; in seiner Autobiographie gibt es von der Sprache her so manche Fragwürdigkeiten und einfach Fehler (wurde nicht sehr sorgfältig redigiert); diese Fehler laß ich einfach stehen, mach jedoch den Leser darauf aufmerksam und sag, wie es richtig lauten müßte. Auf solche Weise bietet sich die Gelegenheit, einer bestimmten Tendenz gegenzusteuern, die bei Sprachanfängern fast immer zu beobachten ist: Daß man nämlich die Träger der Sprache, die man grad am Lernen ist, als eine Art Halbgötter betrachtet, die alles besser können als man selbst und denen man nacheifern soll. So man aber mit genügend Sprachgefühl heutige deutsche und russische Zeitschriften und auch Literatur sich anschaut, so wird deutlich, daß auch ein Muttersprachler nicht davor bewahrt ist, seine Sprache nicht zu beherrschen, und daß solche ihre Muttersprache nicht beherrschende Muttersprachler immer häufiger anzutreffen sind. Janov ist da noch harmlos; und zudem hätte er, bei seinen zweifellos vorhandenen starken Anlagen, unter günstigeren Bedingungen ganz sicher auch seine sprachlichen Fähigkeiten ganz anders entwickeln können.
An Janov schätze ich die unerbittliche Konsequenz; selbst wenn diese Konsequenz stellenweise – besonders in den noch der Bearbeitung und Veröffentlichung harrenden Kapiteln – sich in erniedrigendem, offen g’sagt: unmännlichem Verhalten offenbart. Mein Stil wäre das nicht; es läge mir fern, aus seinem Verhalten für mich ein Ideal zu zimmern oder es anderen anzuempfehlen: ich schätze einfach die Konsequenz, mit der er seinen Weg geht, trotz vereinzelter Fragwürdigkeiten und Lächerlichkeiten.
Für Leute, die mit der Geschichte jener Jahre in allgemeinen Umrissen vertraut sind, kann es dann noch erstaunlich sein (für mich war es zunächst erstaunlich), daß er bei solcher Konsequenz überhaupt überleben konnte. Das hat aber – wie eben aus dieser Biographie deutlich werden kann – damit zu tun, daß in jenen Anfangszeiten des Sowjetsystems jene Unmenschlichkeitsmechanismen sich noch nicht voll ausgestaltet hatten; selbst in der Tscheka gab es immer noch Persönlichkeiten mit einem Gespür für menschliche Werte; und jene unerbittliche Konsequenz, die Janov immer wieder in solche Situationen hineinmanövrierte, in denen ein Überleben unwahrscheinlich schien, aktivierte bei diesen noch nicht ganz verdorbenen Mächtigen eben ihr menschliches Potential und führte somit gleichzeitig zu seiner Rettung.
So viel zu Janov; und wenn vorher der Strom nicht ausfällt, krieg ich det alles gar noch online.
Die Stromversorgung scheint wieder einigermaßen ins Lot gekommen (eigentlich blödsinniger Ausdruck; hierzulande iss die Stromversorgung eben dann „im Lot“, wenn sie nicht funktioniert); versuchen wir denn, in einen geregelten Arbeitsablauf hineinzukommen. „Das erotische Moment beim Durchpieksen des Lügenschleiers“ in die Klamurke zu den Texten hochgeladen; und zwar provozierenderweise ins „Land des Lasters“. Eigentlich gehört es ja tatsächlich dorthin, alsda jeglicher Versuch, den Lügenschleier zu durchpieksen, heutzutage als durch und durch lasterhaft empfunden wird; und interessanterweise am meisten von solchen, die viel von „Wahrheit“ reden. Was, insofern die Wahrheit letzterer häufig in einem nicht durchpiekst werden dürfenden Gespinst unhinterfragter Glaubenssätze besteht, natürlich verständlich ist.
Zweiter Espresso. Stand um sechs auf, nahm die Mail mit der letzten Ladung von X-ens Magisterarbeit in Empfang und, mich unablässig ob des gewaltigen Schwachsinns gar sehr ärgernd, redigierte ich sie (er muß das heute noch abgeben). Vermutlich könnte ich ihm auch sagen, daß das ärgerniserregender Schwachsinn ist, ohne daß ich ihn dabei beleidigen würde. Denn ihn interessiert das alles gar nicht; er unterwirft sich einem idiotischen Ritual, um ein Diplom zu bekommen. Und det iss ja nicht nur er; Tag für Tag werden Hunderttausende von Seiten solchen und noch größeren Schwachsinns verfaßt; und alles nur diplombekommendis causa; und, was das schlimmste ist: für solche Idiotie bekommt man tatsächlich Diplome. Problematisch würde es dann, wenn man irgendwas Gedankendurchsetztes abliefern würde; damit brächte man die diplomvergebenden Instanzen aus dem Konzept und bekäme unter Umständen deswegen kein Diplom. Ein ketzerischer Gedanke: und wenn man plötzlich anfangen würde, diese ganze sinnlos verschleuderte Zeit und Kraft – wie das bei der früheren, vorsintflutlichen „Universitas“ veranlagt war – zum Entwickeln von geistiger Beweglichkeit und Fähigkeiten einzusetzen? Doch dazu müßte „man“ erst das Brotgelehrtentum abschaffen.
Aber insgesamt ist alles sehr lustig; vorausgesetzt man schafft es, verschiedene Dinge, die in grimmem Ernste darauf bestehen, ernstgenommen zu werden, nicht ernst zu nehmen.
(In diesem Zusammenhang fällt mir grad meine pseudoerotische Erzählung "Felix Beppelbeu" ein. Hab den Verdacht, daß manche verstehen, was darin zum Ausdruck kommt...)
Prost.
Lang nichts mehr eingetragen. Und was ich in der Zwischenzeit sonst noch notiert habe ist alles weg: Festplattencrash. Auf dem Regal hinter mir liegt jene Festplatte; da ist der ganze Briefwechsel der letzten Jahre drauf, die ganzen fertigen Texte, Skizzen, Notizen, halbfertige und fast fertige Sachen; alles, was so in den letzten Jahren geschrieben wurde: und ich komm nicht mehr ran. Manches ist veröffentlicht, anderes liegt, ausgedruckt, in wirren Papierstapeln rum, wieder anderes entdeckte ich auf irgendwelchen CDs; das allermeiste aber: unzugänglich auf jener auf dem Regal liegenden Festplatte. Von der Mechanik her ist sie, die Festplatte, in Ordnung; nur die Elektronik ist kaputt. Wenn man die Steuerkarte von einer Festplatte gleichen Typs aufsetzt, kommt man vielleicht wieder an die Daten ran. Vielleicht…
Ich kümmere mich später drum; das Vergangene ist ganz nett; noch wichtiger aber ist es: weiterzuschreiten. Wo viel weg ist, ist umso mehr Platz für Neues; nich?
♦ ♦ ♦
Was war denn so los seitdem? In der Klamurke habe ich einen mit dem Sprachenportal zusammenhängenden Bereich angelegt, welcher der engeren Thematik „Sprache“ gewidmet ist und auch Materialien enthält zum Russischstudium; zunächst alles noch Bauplatz.
Auf Bitte von Freunden hab ich begonnen, mich, zunächst mal publizierenderweise, einer freien Schule in Zkaltubo, Nähe Kutaissi, anzunehmen. Eine entsprechende Seite hab ich innerhalb der Klamurke angelegt; zunächst mal Material zu einem dort betreuten behinderten Künstler. Alles noch mehr oder weniger Bauplatz, aber doch halbwegs vorzeigbar. In den letzten Tagen kamen mir sehr merkwürdige bis hanebüchene Ereignisse mit westlichen „Gönnern“ zu Ohren, über die ich später vermutlich noch berichten werde; doch ist das alles so idiotisch und ungereimt, daß ich erst mal mich vergewissern muß: ob det denn nu wirklich so ist. Und wenn es so ist, werd ich ungeniert berichten.
Am 24. fahr ich für ein paar Tage nach Zkaltubo, um mir selbst vor Ort ein Bild zu machen; gleichzeitig eine gute Gelegenheit, mich etwas vom Stadtleben zu erholen.
♦ ♦ ♦
Ansonsten hab ich angefangen, meine in den letzten Jahren im Internet verstreuten Texte wieder einzusammeln. Vorgestern schrieb ich an Erozuna mit der Bitte, meine dort veröffentlichten Sachen zu entfernen.
So weit mal für heute…
![]()
Seit vorgestern Abend zurück aus Zkaltubo. Konnte mir so ungefähr ein Bild machen, was mit jener Schule los ist, was wie möglich ist und was Illusion; und ansonsten war dieser Abstecher eine recht stressige Angelegenheit. Eigentlich hatte ich ja gedacht, mich in Zkaltubo von dem Leben in Tbilissi zu erholen; doch nun muß ich mich erst mal in Tbilissi von dem Leben in Zkaltubo erholen.
Verstärkt wurde der aus dem Zweck meines Aufenthaltes sich ergebende Stress durch die bedauerliche Tatsache, daß die meiste Zeit über kein Wasser da war. Strom sowieso nicht; der Strom wurde in der Regel am frühen Vormittag eine zeitlang eingeschaltet, und dann wieder am Abend. In der Regel; am Freitag abend wurde er nicht eingeschaltet, und am Samstag vormittag auch nicht. Was sich auch auf die Kommunikation auswirkt, da man wegen des schlecht funktionierenden Ortsnetzes auf Handys angewiesen ist; und Handys funktionieren nun mal nur dann, wenn man den Akkumulator auflädt. Das Wasser wird, so überhaupt, morgens um 8 für zehn bis fuffzehn Minuten aufgedreht; und wenn man sieht, daß das Wasser fließt, läßt man alles stehen und liegen und legt sich möglichst große Vorräte an, die dann halten müssen, bis es wieder aufgedreht wird; was günstigstenfalls am folgenden Tag ist, oder aber an einem der nächsten Tage oder in einer Woche. Am Freitag Abend war im ganzen Haus kaum noch ein Tropfen Wasser, um sich die Hände zu waschen.
Zu früheren Zeiten bauten die Menschen ihre Siedlungen an Bächen und Flüssen oder hoben Brunnen aus. Später begannen sie dann, ausgeklügelte Wasserleitungssysteme zu konstruieren; und die Häuser, die sie fortan bauten, waren auf diese Wasserleitungssysteme hin konzipiert. Das ist sehr bequem: man dreht den Hahn auf, und das Wasser läuft; nicht wie früher, als man alles mit Eimern herbeischleppen mußte. Doch wenn dieses ausgeklügelte System nicht funktioniert, wird es noch viel umständlicher, als das früher war; denn in der Regel ist kein Bach in der Nähe und auch kein Brunnen, von wo man das Wasser herschleppen könnte.
Zu Sowjetzeiten und auch früher war Zkaltubo ein beliebter heilbäderbestückter Kurort; wie überhaupt die Wurzel des Namens Zkaltubo mit Heilquellen und Bädern zu tun hat: mit „zkali“ bezeichnet nämlich der Georgier ebenjene Flüssigkeit, die der Deutsche „Wasser“ nennt.
Heute stößt man auf Schritt und Tritt auf verfallene und verfallende Sanatorien; der Großteil der Bevölkerung besteht aus arbeitslosen Ärzten und Krankenschwestern; und auch mit dem Wasser ist es, eben, nicht mehr ganz so wie früher…
Wozu nun die unter mühsamen und stressigen Umständen errungene Weisheit bezüglich Entwicklungsmöglichkeiten jener Schule nützen könnte – weiß ich nicht. Hege eigentlich eher die Vermutung, daß das kaum jemanden interessiert und daß det alles graue Theorie bleibt. Am Samstag war eine Delegation aus Schweden da; ganz kurz. Versuche, ins Gespräch zu kommen, brachten nichts; ich war dann auch nicht mehr ganz sicher, ob die Schule dieses Volks überhaupt interessiert; und ich verstand immer weniger, wozu sie eigentlich hergekommen waren. Aber sie waren gekommen und fuhren dann gleich weiter. Eine richtige Delegation; mit Fotoapparaten und so. Und, wie bei solchen Delegationen üblich: man schaut kurz rein; und dann fährt man wieder nach Hause, wo es Strom gibt und Wasser und wo überhaupt alles besser ist, und erzählt, wo man gewesen ist.
Dann ergab sich noch die Gelegenheit, Schota kennenzulernen. Er war auf dem Weg, irgendein Maisfeld umzugraben oder so wat in der Richtung (er verdient seinen spärlichen Lebensunterhalt mit körperlicher Arbeit) und schaute vorbei. Kontakt vom ersten Moment an positiv: man versteht sich. Extra für mich modellierte er dann auf die Schnelle noch ein Pferd.
Für jemanden, der in der Provinz aufgewachsen ist und keine besondere Schulbildung hat, spricht dieser als krank und intellektuell minderbegabt eingestufte Mensch ungewöhnlich gut Russisch. Dann hat er einen ausgesprochen gesunden Blick auf das Leben. Sein Problem ist nur, daß er nicht in der Lage ist, seine gesunde Sichtweise in Beziehung zu sehen zu der nicht ganz so gesunden Sichtweise seiner Umgebung; und da er diese gesunde Unverdorbenheit so unreflektiert und selbstverständlich darlebt, erscheint sie in schrillem Kontrast zu der ihn umgebenden ungesunden Gekünsteltheit; und durch diesen schrillen Kontrast zu dem als normal empfundenen Abnormen erscheint das Gesunde an ihm umso schrulliger und krankhafter.
So hat er nicht das geringste Interesse daran, „berühmt“ zu werden. Sieht einfach keinen Sinn darin, weiß nicht, wozu das gut sein könnte. Gia Buchadse, seinen „Entdecker“, schätzt er als Menschen. Daß Gia Buchadse Direktor der Tifliser Kunstakademie ist und eine bekannte Persönlichkeit – interessiert ihn nicht. Daß er begabt ist, weiß er; er nimmt das hin wie eine Naturerscheinung und findet nichts dabei, seinen Lebensunterhalt mit körperlicher Arbeit zu verdienen, da es eine andere Möglichkeit im Moment nicht gibt. Lali, die Schulleiterin, macht sich große Sorgen: wenn er weiterhin den ganzen Tag über körperlich arbeitet, wird er weder Zeit noch Kraft haben, Plastiken für die Ausstellung zu machen. Eine Sorge, die teilweise berechtigt ist. Nur versteht sie nicht, daß Schota sehr große Reserven hat und daß es weniger die körperliche Arbeit ist, die ihn vom Plastizieren abhält, denn vielmehr ihre herrschsüchtige und teilweise auch selbstsüchtige Art, mit der sie ihn zum Plastizieren zwingen will. Das Aktivieren schöpferischen Potentials hat seine eigenen Gesetze; mit Zwang aktiviert man da gar nix, sondern schafft nur Chaos und Widerstände. Mir ist das deutlich; und ich verstehe, daß Schota eben dann am besten und fruchtbarsten seiner künstlerischen Arbeit wird nachgehen können, wenn man ihm nach Kräften hilft, sein Leben so zu leben, wie er es für richtig findet; und dann wird auch körperliche Arbeit und sonstiges von Lali als „Ablenkung“ betrachtetes den künstlerischen Prozeß nicht nur nicht behindern, sondern im Gegenteil unterstützen.
Selbst hatte ich keine Probleme, mich mit Schota zu verständigen. Eigentlich erlebte ich ihn auch nicht als „Behinderten“, sondern mehr als einen Kollegen von der „schöpferischen Front“; und meine Argumente, warum es besser ist, sich neben allem anderem etwas stärker auf seine künstlerische Arbeit zu konzentrieren, verstand und akzeptierte er.
Wir machten ab, daß er bis zum Wochenende die erste Arbeit abliefert; bekräftigten unsere Abmachung mit Handschlag; und ich zweifelte nicht daran, daß er das auch einhalten wird. Lali war genau so sicher, daß er es nicht einhalten wird. Dann unterhielt ich mich noch mit ihm darüber, ob er eine Möglichkeit sähe, von Plastilin auf Ton umzusteigen, da ich Plastilin auf Dauer für nicht geeignet halte. Schota meinte, das ginge; aber er müßte dann größere Figuren machen. Mir scheint zudem, daß jemand, der sich auskennt, ihn in die Arbeit mit Ton einführen müßte; und dann bräuchte man natürlich noch eine Möglichkeit, die Sachen zu brennen. – Lali hielt das alles für unrealistisch: Schota würde immer viel versprechen und nichts halten.
Ich reiste dann am Samstag ab; und am Abend kam ein völlig überraschter Anruf aus Zkaltubo: Schota ist, wie abgemacht, mit der Arbeit erschienen. Was man nicht für möglich gehalten hatte. Man sah ein, daß ich Recht hatte und war sogar erfreut, daß man sich geirrt hatte und daß die Arbeit nun reibungslos weitergehen kann. - Schota war etwas indigniert, daß ich abgereist war; aber das ließ sich dann in Ordnung bringen (ich sagte, man hätte mich aus Tbilissi angerufen, weil dringendes dort zu tun ist); und er fragte, was er nun als nächstes tun soll. Sprach dann die weiteren Arbeiten mit ihm ab.
Denk, daß hier noch einiges zu erwarten ist.
Die Schota-Seite hab ich inzwischen leicht verändert; vor allem die unsinnige „Krankengeschichte“ entfernt. Lali hatte mir den Text so gegeben; ich hatte nur das Russisch korrigiert, es ins Deutsche übersetzt und in solch leicht überarbeiteter Fassung veröffentlicht. Doch wozu einen Menschen so penetrant als „Behinderten“ darstellen? Um vor solchem Hintergrund umso stärker als „Wohltäter“ hervorzutreten? Muß doch nicht sein.
Vor allem, da Schota gar nicht in solchem Maße „behindert“ ist, wie man ihn darstellt. Vor ein paar Tagen hatte ich in seinen Angelegenheiten ein Treffen mit Gia Buchadse, dem Rektor der Kunstakademie; auch ihm scheint Schota nicht sonderlich „krank“; und er geht mit mir einig daß, wenn man ihm hilft, auf die Beine zu kommen, verschiedene Schrulligkeiten vermutlich ganz von selbst wegfallen werden.
Meinem Gedanken, Schota könne von Plastilin auf Ton umsteigen, begegnete er mit Skepsis: Schota denkt in Farben; bei ihm fallen Farbe und Form zusammen; weshalb er bei der Arbeit mit Ton zunächst mal Probleme haben wird. Doch ist er nicht abgeneigt, ihm beim Umstieg oder der Ausweitung auf Ton, unter Beibehaltung der Plastilin-Linie, behilflich zu sein; er könnte speziell einen Mitarbeiter abstellen, der Schota in die Geheimnisse der Arbeit mit Ton einführt. Was man allerdings finanzieren müßte; von Seiten der Kunstakademie würden die zu deckenden Unkosten für 3 Monate schätzungsweise 300 Dollar betragen; und dann müßte natürlich noch Schotas Aufenthalt in Tbilissi finanziert werden; Unterkunft, Essen und so; und eben hier liegt der Haken. Die Kunstakademie hat keine Möglichkeit, das aus eigenem Budget zu finanzieren; mein eigenes Budget reicht grad eben für eigenes Essen und Unterkunft; man wird sehen müssen, wie man det macht.
Daß man im Herbst unter seiner Leitung und unter Aktivierung seiner Kontakte und Möglichkeiten in Tbilissi eine Ausstellung mit Schotas Arbeiten organisieren wird – das ist keine Frage; und vermutlich wird diese Ausstellung dann anschließend im Moskauer Museum für Außenseiterkunst[4] gezeigt, mit dem bereits Kontakt besteht; und so sich weitere Möglichkeiten bieten – auch woanders. Problem ist halt der nicht ganz so einfach zu bewerkstelligende Transport der Plastiken aus Plastilin, und, natürlich, dessen Finanzierung.
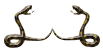
Sonst? Noch so dieses und jenes. Sprach gestern wegen der kaputten Festplatte an einer Adresse vor, die Irakli mir gegeben hatte; doch die meinten, da sei nix mehr zu machen. Aber ich heb sie mal auf; vielleicht findet sich doch noch was.
♦ ♦ ♦
Unter sehr vielem anderem befindet sich dort die Skizze zu einem kurzen autobiographischen Abriß, der den Titel tragen soll „Die Rache des verwirrten Realisten“. Als „verwirrten Realismus“ nämlich bezeichne ich die Weltanschauung, in der ich viele Jahre befangen war und teilweise noch bin; wobei ich mit „Realismus“ den Begriffsrealismus meine, in dem ich, meiner Anlage nach, zu leben neige; welche Anlage, da ich zunächst nix verstand und alles erst sehr viel später aufdröseln konnte, zu ganz merkwürdigen Konflikten und Verhedderungen mit der Ungereimtheit der Umgebung führte. Ausgangspunkt ist ein Zitat aus meiner frühen Kindheit: Meine Mutter hatte verkündet, es gebe zum Mittagessen Kalbfleisch; und ich fragte in tiefem Ernste nach: „Kalbfleisch? Vom Schwein?“
Das hat auf alle einen sehr tiefen Eindruck gemacht und wurde noch über viele Jahre hin zitiert; ohne daß man allerdings den Untergrund verstanden hätte, dem diese Aussage entwachsen ist. Dafür kam ich selbst viele Jahre später in die Lage, ihn, jenen Untergrund, rückblickend zu charakterisieren: Nämlich hatten meine Erfahrungen mit der Erwachsenenwelt in mir die tiefe Überzeugung hervorgerufen, daß Ungereimtheit ein konstituierendes Element der Wirklichkeit ist; und da die Erwachsenen immer Recht haben, muß das denn wohl so sein; und vor diesem Hintergrund kamen mir denn ganz legitime Zweifel, daß etwas, das man „Kalbfleisch“ nennt, irgendwas mit einem Kalb zu tun haben könnte.
Eine aus meiner Entwicklung zum verwirrten Realisten erhalten gebliebene griffige Episode. Damals lebte das als Stimmung; doch da ich es irgendwann schaffte, mich diesen Verwirrungen zumindest ansatzweise zu entwinden, kam ich denn dazu, det alles in Worte zu fassen; und hierauf aufbauend hatte ich denn diesen Werdegang eines verwirrten Realisten darzustellen begonnen. Und Rache – ja nu; det iss nicht so ernst gemeint; zu sehr neige ich dazu, die Dinge von der komischen Seite zu nehmen, als daß ich richtig rachsüchtig sein könnte. Wenn man so will, kann man - cum grano salis - etwa die „Klamurke“ als Racheakt betrachten.
Soviel für heute.
Schon sehr lange nichts mehr eingetragen. Sehr lange. Den Sommer über passierte eigentlich fast überhaupt nichts; außer dem ganz wenigen, das ich selbst mit Müh und Not geschehen lassen konnte. Hielt mich fast die ganze Zeit über in Tbilissi auf, und in Tbilissi: am Schreibtisch. Die ganze Stagnation nervte mich zu sehr, als daß ich ehrlich hätte ausspannen können; und deshalb zwang ich mich, wenigstens ehrlich zu arbeiten. So weit das bei der Hitze möglich war.
Höchstlich interessant die Sache mit Valja. Valja ereilte das Schicksal, daß sie – ohne jemals im Leben irgendeine Grenze überschritten und ins Ausland gereist zu sein – sich in Bezug auf ihre Heimatstadt plötzlich als Ausländerin wiederfand. An irgendeinem nunmehr 45 oder 46 Jahre zurückliegenden Tag erblickte sie in der Sowjetunion, in der Stadt Wladikavkas, das Licht der Welt. Später studierte sie in Wladikavkas Medizin, wurde Gynäkologin. Als junge Frau heiratete sie dann, wie es sich gehört, einen Landsmann aus der Sowjetunion und zog mit ihm in dessen Heimatstadt Kaschuri in der Sowjetrepublik Georgien. Dort lebte sie in biederem Familienleben mit ihrem Manne so lange, alsbis sie selbigens überdrüssig wurde, sich von ihm trennte und nach Tbilissi zog, noch immer in der Sowjetrepublik Georgien. Das Leben in diesem Tbilissi wurde für sie immer schwieriger und unerquicklicher; und Ende letzten Jahre entschloß sie sich, nach Wladikavkas zu ihren Verwandten zu reisen und vielleicht dort zu bleiben. Und nunmehr erfuhr sie am eigenen Leibe die Folgen des Treffens einiger Herren, die sich Anfang der neunziger Jahre um einen runden oder eckigen Tisch herum versammelt hatten und zu dem Beschlusse gekommen waren, daß es die Sowjetunion nicht mehr gibt. Um von Tbilissi in ihre Heimatstadt Wladikavkas zu kommen, mußte sie nun eine richtige Grenze überschreiten; denn Tbilissi lag nun nicht mehr in der Sowjetunion – die es laut Beschluß dieser Herren nicht mehr gab – sondern war die Hauptstadt des Staates Georgien. Aus erwähnten Gründen lag auch Wladikavkas nicht mehr in der Sowjetunion; das gehörte nun zu Rußland. Über ihren Sowjetischen Paß, dieses von einem längst nicht mehr existierenden Staate ausgestellte Dokument, lachte man nur. Nun mußte sie sich denn einen richtigen Paß besorgen. Als erstes ging sie zur russischen Botschaft und fragte, ob sie nicht die russische Staatsbürgerschaft bekommen könne, da sie in Rußland geboren ist und zudem außer ihrer Muttersprache Russisch keine andere Sprache kennt. Doch die Russen winkten ab: Sie habe über zehn Jahre in Georgien gelebt und sei deshalb als Georgierin zu betrachten. Ja nun; vielleicht hätte sie was erreichen können, wenn sie ihrer Bitte mehr Nachdruck verliehen hätte; doch Valja ist nun mal kein kämpferischer Mensch. Dafür bekam sie ohne Umschweife einen Georgischen Paß; wobei es niemanden störte, daß sie kein Wort Georgisch kann. In diesen Georgischen Paß klebte man ihr nun ein russisches Visum, und zusammen mit ihrem Sohn reiste sie nach Wladikawkas. In Wladikawkas lebte sie dann ein halbes Jahr, ohne Aussicht, die Füße auf den Boden zu kriegen, ihren Freunden und Verwandten zur Last fallend, unter erniedrigenden Umständen; und so erniedrigend und schrecklich war das alles, daß ihr Sohn vor Verzweiflung die Orientierung verlor und in die Psychiatrie eingeliefert wurde. Und Anfang Sommer überquerte sie dann, mit stark angeknackstem Sohn, mit stark überzogenem Visum, mit großen Problemen und mit großem Ärger wieder die Grenze, zurück in ihre offizielle Heimat Georgien.
Über Wasser hielt sie sich dank der finanziellen Unterstützung meines Freundes Georges (dank dessen Hilfe hier so einiges Volks überleben und arbeiten kann). Zunächst überlebte sie nur, ohne Arbeit; doch dann schien mir, daß das nicht ganz das Wahre ist; und so schufen wir – ganz im Sinne des Fonds, den wir aus den Einkünften unserer nicht zustandegekommenen wirtschaftlichen Zusammenhänge hatten gründen wollen – extra für sie einen Arbeitsplatz. Das ging ganz einfach: Ich nahm Kontakt auf mit einer Einrichtung, die Krankenpflege organisiert; und die sorgten dafür, daß Valja eine Patientin bekam, die sie zu Hause zu pflegen hatte. In deren Budget war dieser Arbeitsplatz nicht vorgesehen; doch war das auch gar nicht nötig, da die monatliche Summe, die Georges ihr jeden Monat zur Verfügung stellte als Überlebenshilfe, kurzerhand zur Finanzierung dieses Arbeitsplatzes umfunktioniert wurde. Bei der Kranken, die sie nun jeden Tag zu Hause zu betreuen hat, handelt es sich um eine junge Frau, die unter multipler Sklerose leidet. Besonders günstig an der Sache ist, daß die beiden Frauen sich sehr schnell anfreundeten; so daß das nun ganz locker und ohne Krampf weiterläuft und auch gewisse positive Ausstrahlungen hat; unter anderem auch auf Valjas Sohn, für den es auch nicht schlecht ist zu sehen, daß seine Mutter nicht mehr rumhängt und leidet, sondern einer sinnvollen Arbeit nachgeht; und auch sonst scheint sich noch so dieses und jenes in dieser aufgelockerten Atmosphäre zu entwickeln.
Auf dem Foto sieht man Valja ganz zur Linken; im Vordergrund ihre Patientin oder Freundin.
Auch mit unserem Strömungsaggregat, in dessen Umfeld wir jenen Fonds hatten gründen wollen, ist wieder leicht was in Bewegung gekommen; ob sich diese Bewegung durchziehen läßt – ist natürlich die Frage. Immerhin bin ich inzwischen auch etwas klüger worden; weniger in Sachen Technik (mit den mathematischen und technischen Grundlagen der Inversionskinematik, die diesem Aggregat zugrundeliegt, hab ich mich seit Versacken des Projekts aus lauter Frust nicht mehr beschäftigt; ging gar nicht) denn vielmehr in Fragen des Sozialen. Hierüber hab ich bereits berichtet; werde es wohl, um neue Erkenntnisse bereichert, auch noch ausführlicher tun; doch hoffe ich, daß bald genügend Spruchreifes vorliegen wird über eine konstruktive Weiterführung; und solcher konstruktiver Weiterführung – so sie stattfindet – würde ich naturgemäß sehr viel mehr Raum widmen als vergangenen Katastrophen.
![]()
Irgendwas greifbares, das in diesen Monaten zustandekam, wüßte ich kaum zu nennen. Irgendwelche Entwicklungen halt, mit bislang nur wenigen greifbaren Resultaten. - Auf Anraten einer Bekannten hab ich angefangen, meine eigenen russischen Erzählungen nun auch in der Russischecke des deutschen Sprachenportals zu verwerten. Selbst wäre ich nie auf solchen Gedanken gekommen, da Russisch offiziell immerhin nicht meine Muttersprache ist und da ich mit dieser Sprache ja auch tatsächlich nicht aufgewachsen bin. Griff auf Texte zurück, die bereits in meiner zweisprachigen Literaturecke im russischen Sprachenportal veröffentlicht waren, unterzog sie einer stilistischen Überarbeitung und begann dann, sie, so nach und nach, mit wortwörtlicher deutscher Übersetzung und Kommentaren für deutsche Russischlernende zu veröffentlichen.
Auch hatte ich mir aus der Polnisch-Ecke des russischen Sprachenportals die ersten zehn Kapitel des Romans "Mit Feuer und Schwert" von Sienkiewicz im Polnisch mit paralleler russischer Übersetzung heruntergeladen und begann, stillvergnügt vor mich hin zu lesen. Ab elftes Kapitel war dann Schluß mit der parallelen russischen Übersetzung; die Fortsetzung lud ich mir aus einer polnischen Online-Bibliothek herunter und las weiter ohne Netz und doppelten Boden. Das funktionierte. Inzwischen hab ich angefangen, den gleichen Roman mit wortwörtlicher deutscher Übersetzung und Kommentaren für deutsche Polnischlernende zuzubereiten. Auch das klappt ohne Probleme.
Deutsche Belletristik schrieb ich in all diesen Monaten – außer vereinzelten im ersten Skizzenstadium steckengebliebenen Anläufen – kaum. Muß ja auch nicht sein.
Dafür hab ich mich nun zu diesem in waschechtem Deutsch verfaßten Eintrag aufgerafft.
So weit mal für heute.
[Deutscher Wahlkampf aus Tiflisser Vogelperspektive]
Obwohl ich nichts Gehaltvolles zu jenen Abläufen zu sagen wüßte (was ließe sich schon Gehaltvolles sagen zu jenem wirren, jeden Gehaltes entbehrenden Theater) drängt es mich, ein paar Worte dazu zu äußern. Da ich weitab vom Schuß bin, vor allem aber: um mich zu schonen, hab ich das alles nur ganz am Rande mitverfolgt; so daß mir unter Umständen relevante Einzelheiten – sofern in diesem Brei solche vorhanden waren – entgangen sein können.
Sagen kann ich, daß ich selten so was dummes und widerliches erlebt habe wie diesen deutschen Wahlkampf mitsamt Folgeerscheinungen; und vor diesem Hintergrund wäre es wohl am sinnvollsten und konsequentesten, wenn der Platz am Ruder dem oder der dümmsten zufallen würde; solcherart würde in dieser wirren Trübe wenigstens die vorherrschende Tendenz etwas deutlicher und griffiger[5].
Und irgendwann, vor langen Zeiten, bezeichnete man die auf jenem Territorium lebende Bevölkerung mal als "Volk der Dichter und Denker"… Damals wohl zu Recht; aber wie man sieht: die Zeiten ändern sich…
Zwischendurch habe ich auch Fernsehauftritte von Putin mitverfolgt. Mit Putin kann man einverstanden sein oder auch nicht; aber eines ist zweifelsfrei klar: daß das nämlich ein Mensch ist, der denkt und der in der Lage ist, klar und prägnant und auch fehlerfrei seine Gedanken zu formulieren (und vielleicht liegt hier einer der Gründe für solch heftige Kontroversen: weilnämlich das, was er sagt, griffig ist; im Gegensatz zu dem Wörterbrei mancher seiner deutschen "Kollegen")

1) Anmerkung Januar 2013: Die "Violette Auster" war angelegt als mehrsprachiger internationaler Online-Nightclub mit Text und Bild (Deutsch und Russisch zunächst, aber mit Tendenz zur Ausweitung in andere Sprachen). Ich zog mich aus meiner eigenen Schöpfung zurück, weil das angestrebte Niveau sich nicht halten ließ. Und ohne dieses Niveau schien die Sache mir witzlos; geknipst und geschrieben wird auch so genug. Die Webmasterin machte dann alleine weiter. - Anmerkung November 2019: Jene "Violette Auster" hielt sich recht lange online; doch inzwischen ist sie weg.
2) Anmerkung Januar 2013: Zusammen mit einer bereits vorher im Rahmen des Sprachenportals eröffneten zweisprachigen Literaturseite hat diese deutsche Filiale sich seitdem gut entwickelt. Zur Zeit stagniert sie; steht aber dafür kurz davor, in eine umfassendere Sache eingebaut zu werden.
Anmerkung Mai 2016: Die angekündigte „größere Sache“ lief tatsächlich an und krachte kurz darauf zusammen. Die beiden Sprachenportal-Seiten sind inzwischen liquidiert; meine russischen Texte findet man, zusammen mit den deutschen, teilweise in der Klamurke; verstreutes früher im Sprachportal veröffentlichtes Material findet man nun hier.
3) Näheres in der klamurkischen Ecke "Erlebnisse mit den Auswirkungen unserer vermurxten kulturellen Situation auf das soziale Leben", Abteilung "Absurde Abenteuer mit Strömungsaggregaten"
4) Nachbemerkung Januar 2013: Jenes Museum ist inzwischen nach Montenegro umgezogen; die Facebook-Seite findet man hier
5) Nachbemerkung Januar 2013: Tatsächlich kam es dann zu einem energischen 'alternativlosen' Herausgestalten jener vorherrschenden Tendenz; und immer deutlicher werden die Konsequenzen. Vielleicht lernt man sogar was dabei.
Anmerkung Mai 2016: Inzwischen ist dank der Mithilfe jener Dame Deutschland am Rande einer kaum noch zu vermeidenden Katastrophe. Ob man daraus was lernen wird - wird man sehen.
